Das Recht auf Auskunft einer betroffenen Person ist eines der wesentlichen Rechte von Betroffenen durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Verantwortliche sind danach verpflichtet eine Bestätigung darüber zu erteilen, ob und in welchem Umfang Verantwortliche personenbezogene Daten verarbeiten.
Doch dieses Recht auf Auskunft ist manchmal von betroffenen Personen sehr weit ausgelegt.
Doch dabei ist ein gewisser Rahmen zu beachten.
Das OLG Nürnberg
Genau hierzu hat sich nun das Oberlandesgericht Nürnberg (OLG Nürnberg) in seinem Urteil vom 14.03.2021 (Az.: 8 U 2907/21) geäußert.
In der Berufungsinstanz stritten ein Versicherungsnehmer (Kläger) und eine Versicherungsgesellschaft (Beklagte) über die Unwirksamkeit mehrerer Beitragserhöhungen im Rahmen einer zwischen ihnen bestehenden privaten Krankenversicherung sowie über hieraus folgende bereicherungsrechtliche Erstattungsansprüche.
In Verbindung hiermit machte der Kläger auch einen Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO geltend und verlangte mithin Auskunft darüber, ob und wann in den vergangenen Jahren Beitragsanpassungen erfolgten und um Vorlage der entsprechenden Dokumente.
Das OLG Nürnberg positionierte sich bezüglich dieses Antrags sehr deutlich und sah für solch ein Auskunftsersuchen insbesondere keine Rechtsgrundlage in Art. 15 Abs. 1 DSGVO.
Das Gericht stufte den Antrag des Klägers als rechtsmissbräuchlich ein und verwies auf die Berücksichtigung des Schutzzwecks der DSGVO und den Erwägungsgrund 63, der in Satz 1 besagt:
„Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.“
Nicht im Sinne der DSGVO
Nach Auffassung des Gerichts verfolgte der Kläger gerade nicht diese von der DSGVO umfassten, sondern andere Zwecke und führte aus:
„Um ein solches Bewusstwerden zum Zweck einer Überprüfung der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten geht es dem Kläger aber ersichtlich nicht. Sinn und Zweck der von ihm begehrten Auskunftserteilung ist vielmehr – wie sich aus der Koppelung mit den unzulässigen Klageanträgen auf Feststellung und Zahlung zweifelsfrei ergibt – ausschließlich die Überprüfung etwaiger von der Beklagten vorgenommener Prämienanpassungen wegen möglicher formeller Mängel nach § 203 Abs. 5 WG.
Eine solche Vorgehensweise ist vom Schutzzweck der DS-GVO aber nicht umfasst (vgl. OLG Hamm, BeckRS 2021,40312 Rn. 11; LG Wuppertal, r+s 2021, 696 Rn. 33).“
Das Weigerungsrecht
Das Gericht stellte auch klar, dass gegen solche rechtsmissbräuchlichen Auskunftsansprüche, wie der des Klägers, dem Verantwortlichen ein Weigerungsrecht aus Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. b DSGVO zusteht.
Das OLG Nürnberg sieht keine strenge Begrenzung des Weigerungsrechtsrechts des Verantwortlichen und führt aus:
„Die Vorschrift führt zwar lediglich die häufige Wiederholung als Beispiel für einen „exzessiven“ Antrag auf. Die Verwendung des Wortes „insbesondere“ macht aber deutlich, dass die Vorschrift auch andere rechtsmissbräuchliche Anträge erfassen will […].“
Sinn und Zweck
Diese klare Positionierung des OLG Nürnberg ist zu begrüßen.
Denn es ist zu bewerten, ob ein Auskunftsersuchen dem Sinn und Zweck der DSGVO entspricht oder vielmehr andere Interessen verfolgt.
Genaue Prüfung
Doch erst nach einer genauen Prüfung bzw. Abwägung ist beim einem Auskunftsersuchen das Weigerungsrecht aus Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. b DSGVO anzuwenden.
Also lassen Sie sich gut beraten.
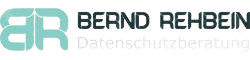

1 Kommentar